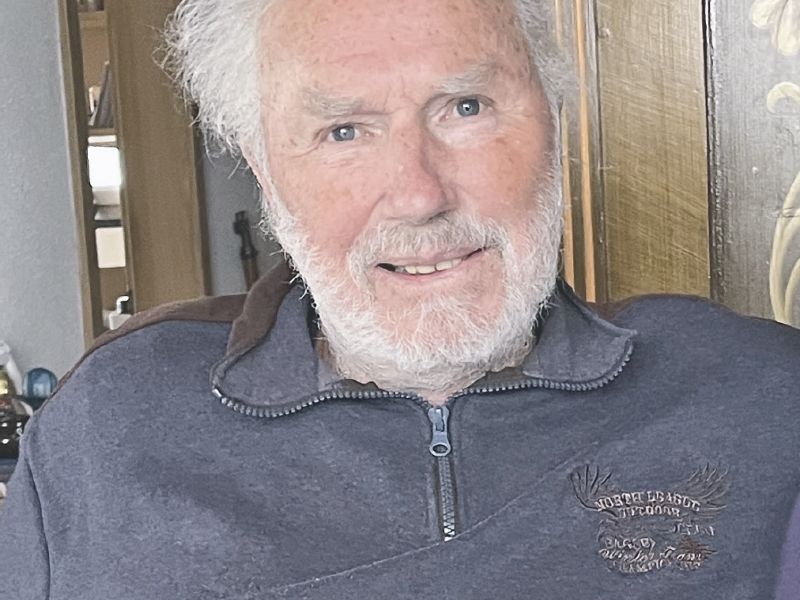Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Bundesrat bekräftigt die Entschuldigung • An der Sitzung vom 19. Februar hat der Bundesrat ein im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) erstelltes Rechtsgutachten zur Verfolgung der Jenischen und Sinti anerkannt, dass die im Rahmen des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» erfolgte Verfolgung der Jenischen und Sinti nach Massgabe des heutigen Völkerrechts als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu bezeichnen ist.
Der Bundesrat anerkennt, dass die im Rahmen des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» erfolgte Verfolgung der Jenischen und Sinti nach Massgabe des heutigen Völkerrechts als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zu bezeichnen ist. Für das begangene Unrecht bekräftigt der Bundesrat gegenüber den Betroffenen die 2013 ausgesprochene Entschuldigung. Das EDI wird mit ihnen klären, inwiefern über die bereits ergriffenen Massnahmen hinaus noch Bedarf zur Aufarbeitung der Vergangenheit besteht.
Bis 1981 waren in der Schweiz über hunderttausend Kinder und Erwachsene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen oder Fremdplatzierungen betroffen. Die Massnahmen richteten sich gegen Personen, die aus ärmeren Verhältnissen stammten oder deren Lebenswandel nicht der damals akzeptierten gesellschaftlichen Norm entsprach. Dazu gehörten auch Menschen mit fahrender Lebensweise, etwa Jenische und Sinti. Die Kindeswegnahmen erfolgten primär im Rahmen des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse», eines Programms der Stiftung Pro Juventute. Zwischen 1926 und 1973 hatten die Verantwortlichen des «Hilfswerks», häufig unter Mithilfe der Behörden, rund 600 jenische Kinder ihren Eltern weggenommen und unter Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien zwangsweise in Heimen, Erziehungsanstalten und bei Pflegefamilien versorgt. Von den Kindeswegnahmen waren auch Sinti betroffen. Erwachsene, die als Minderjährige fremdplatziert worden waren, wurden unter Vormundschaft gestellt, in Anstalten untergebracht, mit einem Eheverbot belegt und in Einzelfällen auch zwangssterilisiert. Neben Pro Juventute waren auch kirchliche Hilfswerke und Behörden tätig, sodass von gegen 2000 Fremdplatzierungen ausgegangen werden muss.
In den 1970er- und 1980er-Jahren geriet diese Praxis zunehmend in die Kritik der Öffentlichkeit. Politische Forderungen nach Aufarbeitung der Vergangenheit wurden laut. 1988 und 1992 bewilligte das Parlament auf Antrag des Bundesrats insgesamt 11 Millionen Franken zur Äufnung eines Fonds «zur Wiedergutmachung für die ‹Kinder der Landstrasse›». 2013 bat der Bundesrat alle Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen um Entschuldigung. Seither wurden auf Bundesebene verschiedene Massnahmen zur Aufarbeitung und Entschädigung angestossen und umgesetzt (vgl. Kasten).
Juristisches Gutachten
Im November 2021 ersuchte die «Union des Associations et des Représentants des Nomades Suisses» (UARNS) den Bund um Anerkennung eines Völkermords (Genozids) an den Schweizer Jenischen und Sinti in Zusammenhang mit dem «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse». Im Januar 2024 verlangte die «Radgenossenschaft der Landstrasse» die Anerkennung eines «kulturellen Genozids». Angesichts der Schwere der Vorwürfe beschloss das EDI, einen unabhängigen Experten beizuziehen. Er beauftragte in Absprache mit den beiden Gesuchstellerinnen im März 2024 Prof. Dr. Oliver Diggelmann (Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht, Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Universität Zürich) mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens. Der Auftrag hatte zum Ziel, zu klären, ob die Schweiz eine völkerrechtliche Verantwortung für die Verletzung der Tatbestände «Genozid» oder «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» gegenüber den Jenischen und Sinti trägt.
Kein Genozid
Das Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass die Kindeswegnahmen, die beabsichtigte Zerstörung von Familienverbänden zur Eliminierung der fahrenden Lebensweise und zur Assimilierung der Jenischen und Sinti nach den heute geltenden völkerrechtlichen Standards als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» im Sinne des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) zu bezeichnen sind. Der Staat trägt dabei nach heutigem Rechtsverständnis eine Mitverantwortung für die begangenen Taten. Die Verfolgung der Jenischen und Sinti wäre ohne die Mithilfe staatlicher Behörden aller Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) nicht möglich gewesen.
Es gab insbesondere enge personelle und finanzielle Verflechtungen zwischen dem Bund und der Stiftung «Pro Juventute», die das Programm «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» betrieb. Während der Tatbestand eines «Verbrechens gegen die Menschlichkeit» erfüllt ist, liegt aus rechtlicher Sicht kein (kultureller) Genozid vor: Ein Tatbestand «kultureller Genozid» (Vernichtung der kulturellen Existenz) gibt es im Völkerrecht nicht. Gemäss Rechtsgutachten ist auch kein Genozid im engeren Sinne gegeben, da die dafür notwendige «genozidäre Absicht» (Absicht zur physischen oder biologischen Vernichtung von Menschen) nicht gegeben ist.
Bekräftigung der Entschuldigung
Der Bundesrat hat die Ergebnisse des Rechtsgutachtens zur Kenntnis genommen. Er hat ein Schreiben an die Gemeinschaft der Jenischen und Sinti gerichtet, in der er die Entschuldigung des Bundesrats gegenüber den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen bekräftigt und betont, dass zu diesen Opfern auch die Jenischen und Sinti gehören. Die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern, Elisabeth Baume-Schneider, drückte gegenüber Vertreterinnen und Vertretern der Jenischen und Sinti die Betroffenheit des Bundesrats auch persönlich aus. Sie erinnerte dabei an die Notwendigkeit, das erfolgte Unrecht nicht zu vergessen. In diesem Kontext wird das EDI im Dialog mit den Betroffenen bis Ende 2025 klären, inwiefern über die bereits ergriffenen Massnahmen hinaus noch weiterer Bedarf zur Aufarbeitung der Vergangenheit besteht.
Erfolgte Massnahmen
Bereits erfolgte Massnahmen zur Aufarbeitung von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen (Auswahl):
1983 veröffentlichte der Bund den Bericht «Fahrendes Volk in der Schweiz – Lage, Probleme, Empfehlungen». Im Jahr 1998 liess der Bund eine historische Studie über die Tätigkeiten des «Hilfswerks» erstellen.
Seit 1986 richtet der Bund jährlich Bundesbeiträge an die «Radgenossenschaft der Landstrasse» und seit 1997 auch an die Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende» aus.
1988 und 1992 bewilligte das Bundesparlament auf Antrag des Bundesrats insgesamt 11 Millionen Franken zur Wiedergutmachung für die Opfer des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse».
2013 bat der Bundesrat alle Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 um Entschuldigung.
2014 trat das Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen in Kraft. Ausserdem wurde ein Soforthilfefonds errichtet.
2017 trat das Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Kraft. Es sieht namentlich Solidaritätsbeiträge an die Betroffenen (darunter auch Jenische und Sinti), die Beratung und Unterstützung der Betroffenen sowie die wissenschaftliche Aufarbeitung vor.