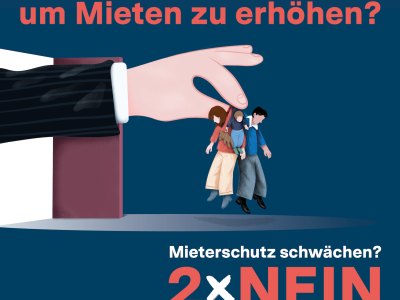Tauziehen um die AHV
Abstimmung | Am 3. März kommen zwei Initiativen zur AHV an die Urne: eine Erhöhung des Rentenalters und eine 13. AHV-Rente. Eine Erhöhung soll die AHV nachhaltig stärken, bei der 13. Rente bereitet vor allem die Finanzierung Kopfzerbrechen.

Die «Alters- und Hinterlassenenversicherung» AHV gilt als Herzstück des Schweizer Sozialstaates – und ist immer wieder Gegenstand von politischen Debatten. Bereits 20 Mal hat das Stimmvolk seit deren Einführung über die Altersvorsorge abgestimmt. Angenommen wurde das entsprechende Gesetz im Juli 1947, ein Jahr später wurden die ersten Renten ausbezahlt. Die AHV war eine Folge des damaligen politischen Aufbruchs der Nachkriegszeit. Sie entstand auch aus einer Volksinitiative von 1942, die von den Linken und dem Freisinn getragen wurde, die damalige Lohn- und Verdienstausfallersatzordnung (LVEO) in die AHV umzuwandeln. Die Renten waren damals aber noch sehr tief. Die erste Rente betrug gerade mal sieben Prozent eines Monatslohns. Das reichte nicht zum Leben, und die Frauen gingen noch leer aus. Den die Ehepaarrente wurde dem Mann ausbezahlt.
Heute beträgt die Minimalrente für eine Einzelperson 1225 Franken, die Maximalrente liegt bei 2450 Franken. Auch dies ist wenig. Die Sozialhilfe des Kantons Bern errechnet bei Einzelpersonen beispielsweise einen (minimalen) Existenzbedarf von rund 2200 Franken. Die AHV-Rente liegt in gewissen Fällen also deutlich unter dem Existenzminimum. Mit Ergänzungsleistungen und Leistungen aus der Pensionskasse kann dieser Betrag erhöht werden. Ergänzungsleistungen erhält man grundsätzlich dann, wenn die Rente die minimalen Lebenskosten nicht deckt. Weil die AHV-Rente zu tief sei, haben verschiedene Gewerkschaften mit Unterstützung von Politikern und Politikerinnen die Initiative für eine 13. AHV-Rente lanciert. Über diese wird am 3. März abgestimmt. Die Initiative lässt die Finanzierung grundsätzlich offen, vorstellbar sind aber eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge beim Lohn oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Auftrag nicht erfüllt
«Die AHV erfüllt heute ihren verfassungsmässigen Auftrag nicht», ist Beat Haldimann von der Gewerkschaft Syndicom und Co-Präsident des Gewerkschaftsbundes Thun überzeugt. Denn die Rente aus der ersten Säule reiche nicht aus zur Existenzsicherung. Für ihn ist klar: «Eine 13. AHV-Rente ist ein Schritt in die richtige Richtung.» So würde die Annahme der Initiative die Situation der aktuellen und künftigen Rentnerinnen und Rentner verbessern. «In den letzten Jahren haben die Krankenkassenprämien und die Teuerung eine ganze Monatsrente weggefressen.» Guiseppe Reo von der Gewerkschaft Unia und ebenfalls Co-Präsident des Gewerkschaftsbundes Thun sagt: «Ein Zehntel der Rentnerinnen und Rentner sind bereits ab dem ersten Tag ihrer Pensionierung auf Ergänzungsleistungen angewiesen.» Einem grossen Teil der Rentnerinnen und Rentner gehe es also nicht gut. Dies, obwohl in der Bundesverfassung stehe, dass die AHV zum Leben ausreichen müsse.
«Ich bin mir bewusst, dass es Rentner gibt, die finanziell knapp drin sind. Diesen muss aber gezielt geholfen werden», sagt Reto Jakob, Gemeindepräsident von Steffisburg und SVP-Grossrat. Die SVP kritisiere vor allem das Giesskannenprinzip der Initiative. Denn unabhängig von der finanziellen Situation sollen alle von einer 13. Rente profitieren. «Die jährlichen Zusatzkosten von rund 5 Milliarden Franken müssen irgendwo eingespart oder zusätzlich eingenommen werden», so Reto Jakob weiter. Aus seiner Sicht sei es nicht richtig, wenn alle mit zusätzlichen Lohnabzügen dafür aufkommen müssten. «Auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer belastet die Familien und zusätzlich die Rentner selbst», erklärt Reto Jakob weiter.
Gemäss Katja Riem, SVP-Nationalrätin aus Noflen, würde eine Finanzierung über Lohnabgaben und die Mehrwertsteuer vor allem den Mittelstand treffen. «Längerfristig stellt sich die Frage, wie lange die AHV so noch bestehen könnte», so Katja Riem weiter. «Wer glaubt, dass das Geld dafür anderswo eingespart werden kann, den muss ich leider enttäuschen.» Denn sparen oder umlagern sei mit den aktuellen Mehrheiten in den Räten nicht möglich. «Alle 40 Sparanträge der SVP bei der letzten Budgetdebatte im Dezember 2023 wurden abgelehnt.» Doch auch sie gibt zu, dass Altersarmut besonders bei Frauen oder Selbstständigen «tatsächlich ein Problem» sei. Eine 13. Rente sei jedoch kein probates Mittel, um die Situation zu verbessern. «Meine Lieblings-Lösung wäre die Steuerbefreiung der Renten», so Katja Riem. «Dieses Anliegen wurde von der SVP eingebracht, jedoch erst kürzlich im Parlament abgewiesen.» Eine weitere mögliche Lösung sieht sie in einer Motion von Melanie Mettler der grünliberalen Partei aus Bern, die kürzlich im Nationalrat überwiesen wurde. Die Motion verlangt, dass bedürftige Rentnerinnen und Rentner eine Rentenerhöhung erhalten. Gemäss Katja Riem werden also durchaus Lösungen gesucht, die sinnvoller sind als das «Giesskannenprinzip».
Soziales Modell?
Für die Linken macht das bisherige Finanzierungsmodell über Lohnprozente allerdings Sinn. «Der Prozentsatz ist für alle gleich», meint Beat Haldimann. «Deshalb zahlen Gutverdienende wesentlich mehr ein als Geringverdienende.» Das «Umlageverfahren» sei das sozialste Modell. Denn: «Der höchstverdienende CEO bezahlt einiges mehr, als er jemals bekommen wird.» Weil die Rente «gedeckelt» sei, kriege eine solche Person nicht mehr als ein Angestellter mit einem Jahreslohn von etwas mehr als 90 000 Franken. Auch für Giuseppe Reo ist das aktuelle Finanzierungsmodell «beispielhaft». Denn «alle, die Beiträge bezahlen, bekommen auch eine Rente, und das ist richtig so. Damit garantieren wir auch für die nächsten Generationen eine solide AHV und eine Rente».
Für Reto Jakob hingegen müsste man eher über eine Erhöhung des Rentenalters diskutieren. «Dies würde die AHV nachhaltig stärken.» Das System mit den Ergänzungsleistungen funktioniere gut, müsse aber allenfalls an veränderte Bedingungen angepasst werden. Auch das System mit den drei Säulen sei ein Erfolgsmodell. «Es ist aber an uns, damit vernünftig und solidarisch umzugehen.» Dazu gehöre auch, dass man sich bereits früh Gedanken über die Pensionierung mache. Denn eines ist unumstösslich: Älter werden wir alle!
Renteninitiative
Nebst der Initiative für eine 13. Monatsrente wird am 3. März auch über eine Initiative zur Erhöhung des Rentenalters abgestimmt. Die «Renteninitiative» verlangt eine Erhöhung des Rentenalters um ein Jahr. Von 2028 bis 2033 soll das Rentenalter von Männern und Frauen schrittweise auf 66 Jahre erhöht werden. Ab 2033 soll dann das Rentenalter entlang der durchschnittlichen Lebenserwartung automatisch weiter steigen. Bei diesem Modell rechnet man mit einem Anstieg des Rentenalters um einen Monat pro Jahr ab 2033. Die Initiative geht davon aus, dass die langfristige Sicherung der AHV aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung in Gefahr sei.