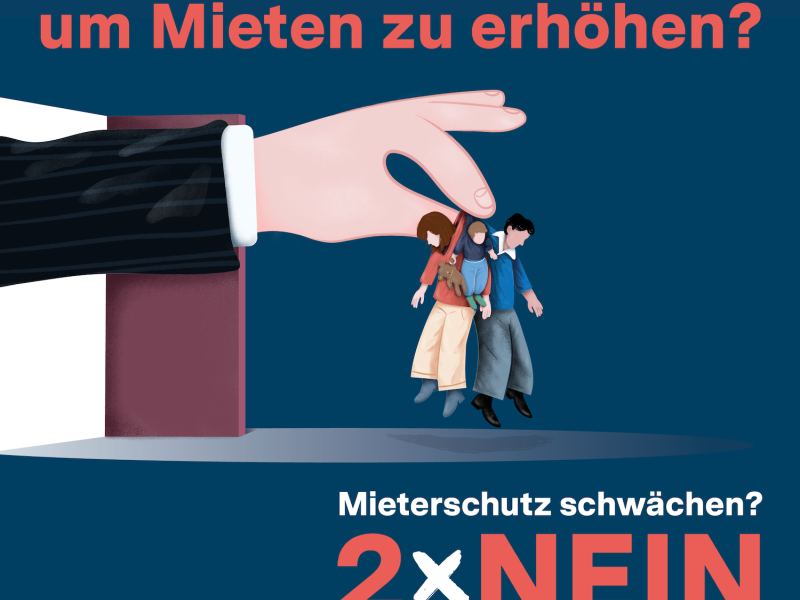Das Amt des Gemeindepräsidenten
Politik • Sich für ein politisches Amt in der eigenen Gemeinde zu engagieren, kommt für immer weniger Menschen in Frage. Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten aus der Region erklären, warum sie das Amt übernehmen wollten.

Wie im Historischen Lexikon der Schweiz steht, entstand das Amt des Gemeindepräsidenten der Funktion nach im Zug der Kommunalisierung im Hochmittelalter. Die kommunale Leitungsaufgabe hiess damals noch Ammann, Schultheiss, Vogt, Meier oder Bürgermeister. In der Helvetik schliesslich etablierte sich der Begriff Präsident bzw. Président.
Die Bundesverfassung lässt den Kantonen bezüglich ihrer inneren Organisation zwar freie Hand. Doch in allen Kantonen liegt die Gemeindeführung in den Händen kollegialer Räte mit einem Gemeindepräsidenten an der Spitze.
Die Wahl des Gemeindepräsidenten erfolgt aus dem Kreis der Gemeinderäte. Das passiert entweder durch eine Urnenwahl, Wahl in der Gemeindeversammlung oder durch eine Parlamentswahl für eine Amtszeit von zwei bis fünf Jahren. Vermehrt wird das fachlich, zeitlich und persönlich anforderungsreiche Amt als Vollamt vergeben.
Sinn, Vielfalt und Teamwork
Den Reiz, als Gemeindepräsident tätig zu sein, sieht Daniel Ott Fröhlicher in der Sinnhaftigkeit des Tuns. Das, was er als Gemeindepräsident von Rubigen mache, sei ein Einsatz zugunsten der Allgemeinheit. Auch gefalle ihm der generalistische Aspekt des Amts. Er müsse einen «Überblick über ganz unterschiedliche Themen erlangen, ohne den Anspruch zu haben, die Fachspezialisten ersetzen zu können», so Ott Fröhlicher. Zudem könne er Initiativen anstossen und vorantreiben.
Im Bereich der Personalführung möchte Rubigens Gemeindepräsident für ein gutes Arbeitsklima und Motivation sorgen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Gemeindeteam. Gemeindeversammlungen, Gemeinderatssitzungen und Sitzungen zu fachlich-politischen Themen mit Externen zu moderieren, fordert ihn heraus. Schliesslich besteht das Ziel solcher Sitzungen darin, mit allen Beteiligten einen Konsens zu finden.
Die meiste Zeit verbringe Ott Fröhlicher mit der Lektüre von E-Mails, Anträgen und Unterlagen für die Gemeinderatssitzung. Auch das Schreiben von Reden für verschiedene Veranstaltungen und das Verfassen der Editorials für die Gemeindezeitschrift gehören zu seinem täglich Brot. Damit einher gehen weitere Vernetzungs- und Kommunikationsaufgaben. Ebenfalls kümmere er sich um das Coaching für das Gemeindekader und die Gemeinderäte.
Partizipation fördern
Die grösste Herausforderung liege gemäss Ott Fröhlicher in der Förderung politischer Projekte. Als Beispiel nennt er die Wiederbelebung der geschlossenen Dorfbeiz. «Das Interesse an Politik und die aktive Beteiligung in der Bevölkerung nehmen ab», sagt der Gemeindepräsident aus Rubigen weiter. Deshalb möchte er mehr Partizipation ermöglichen und Emotionen wecken. Dafür brauche es viel Geduld, einen langen Atem und viel Überzeugungsarbeit, gerade bei Veränderungen. «Gleichzeitig ist der eigene Handlungsspielraum durch Gesetze und Kompetenzregelungen sehr begrenzt», so Ott Fröhlicher weiter. Das bedeutet für ihn, dranzubleiben, optimistisch zu sein und andere zu begeistern.
Eine weitere Herausforderung liege in den vielen wiederkehrenden Routinearbeiten, die von aussen kaum wahrgenommen würden, gleichzeitig aber viel Energie und Zeit beanspruchten. Der Schlüssel zum Erfolg liege hier darin, effizienter zu arbeiten. Das gelinge beispielsweise dadurch, mehr Kompetenzen an Kolleginnen und Kollegen zu delegieren.
Das sinkende Interesse an Politik erklärt sich Ott Fröhlicher mit der zeitlichen Verfügbarkeit. Viele Menschen seien beruflich und privat eingespannt und fühlten sich stark unter Druck. «Deshalb muten sie sich ein Engagement in der Gemeinde nicht zu», sagt Ott Fröhlicher, «insbesondere, da dieses meist in der Freizeit geleistet werden muss.» Nur selten unterstützten Arbeitgebende einen solchen Einsatz, entweder weil sie es nicht wollten oder könnten. Damit einhergehend entspreche die Entschädigung nicht dem tatsächlichen Aufwand. Hinzu komme die abschreckende Wirkung der verstärkten Öffentlichkeit durch Social Media und deren potenziellen Missbrauch. Man denke hier an Fake News und Diffamierungen aller Art.
All diese Überlegungen lassen Ott Fröhlicher zum Schluss kommen, dass «Gemeindepolitik attraktiver gelebt werden muss». Dafür brauche es verschiedene Projekte und kreative Spielräume, in denen nicht nur die Verwaltung von Routineaufgaben im Fokus stünde.
Kontakt mit Menschen
In ihrer Tätigkeit als Gemeindepräsidentin von Oberdiessbach geniesst Bettina Gerber die Begegnungen mit Menschen und das Übernehmen von Verantwortung. «Auch schätze ich die Zusammenarbeit mit meinen Ratskollegen, der Verwaltung und den Nachbargemeinden», so Gerber. Sie führe viele Gespräche, im Zusammenhang mit konkreten Geschäften, «aber auch, wenn irgendwo der Schuh drückt». Dann sei ihre Person gefragt.
Die grösste Herausforderung im Amt als Gemeindepräsidentin liege ihrer Ansicht nach darin, eine möglichst gute Lösung für möglichst viele Bürger zu finden. «Da man es aber nie allen recht machen kann, bedeutet das auch, hinzustehen und zu erklären», sagt Gerber, «und Kritik einzustecken.» Dabei helfe ein breiter Rücken und auch, immer wieder den Kopf zu lüften.
Wer im Gemeinderat oder als Gemeindepräsidentin tätig sein wolle, müsse Verantwortung übernehmen können. «Davor sollte niemand Angst haben», sagt Gerber. Mit dem Amt erschlössen sich einem viele Hintergründe über die eigene Gemeinde, die Wege der Politik und der Verwaltung. Obschon man bereit sein müsse, Zeit zu investieren und zu lernen, «kann man eigentlich nur profitieren».
Kommunizieren können
In ihrer Tätigkeit als Gemeindepräsidentin von Grosshöchstetten freut sich Christine Hofer darüber, direkten Einfluss auf die Umsetzung von Projekten in der eigenen Gemeinde nehmen zu können. «Gemeinsam mit dem Gemeinderat prägt und priorisiert man diese Projekte und trägt massgeblich an der Entwicklung der Gemeinde mit und dient der Bevölkerung», so Hofer.
Auch sie verbringe viel Zeit mit dem Aktenstudium, Sitzungsvorbereitungen und -leitungen. Damit einher gehen die kommunikativen Aufgaben: Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, Besprechungen mit verschiedenen Anspruchsgruppen, das Bearbeiten von Mailanfragen, die Mitarbeit in verschiedenen Gremien und Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen.
Die Wichtigkeit der Kommunikation nach innen und aussen liege auch in den immer komplexer werdenden Geschäften. «Ein Geschäft oder Projekt löst beispielsweise hohe Investitionskosten aus, die sich allenfalls auch auf die steuerliche Belastung der Bevölkerung auswirken», erklärt Hofer. Umfassend zu erklären, weshalb man nun eine Investition tätige oder weshalb nicht, sei anspruchsvoll und oft auch herausfordernd. Auch die Frage, wann der Bevölkerung was wie kommuniziert werde, erweise sich als herausfordernd. Dabei dürfe das Ziel nicht aus den Augen verloren werden: «Grundsätzlich muss es immer darum gehen, die Gemeinde voranzubringen.» Dafür sei es unerlässlich, im Gemeinderat als Team zu arbeiten.
Wer kommuniziert, muss immer mit Rückmeldungen rechnen. Die Bevölkerung äussere sich gemäss Hofer differenzierter, hinterfrage Entscheide kritisch. «Das muss man aushalten können.» Zudem sei die Wertschätzung gegenüber der politischen Arbeit etwas verloren gegangen. «Kritisiert wird schnell», so Hofer, «wenn die Mitarbeit gefordert ist, sieht es dann oft anders aus.»
In Anbetracht aller Aufgaben seien die Entschädigungen oft zu tief. Es sei kaum möglich, das Pensum im Beruf zu reduzieren. «Das Behördenamt benötigt im Schnitt zwischen zwanzig und dreissig Prozent. Das Präsidium beinhaltet im Minimum fünfzig Prozent, je nach Grösse der Gemeinde.»
Koordination und Vereinbarkeit
Auch Carl Bütler, Gemeindepräsident von Toffen, sieht den Reiz des Gemeindepräsidiums darin, die Gemeinschaft zu tragen, an der Gemeinschaft mitzuarbeiten und auch der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, nicht nur zu nehmen. Hinzu kämen die sehr spezifischen und interessanten Aufgaben, die mit dem Amt einhergingen. Diese reichten von der Ortsplanung und -entwicklung bis hin zu Anliegen von Menschen, mit denen man zusammenarbeite.
Die Geschäfte seien es dann auch, die am meisten Zeit beanspruchten. «Dies können Ratsgeschäfte sein, Projektbegleitungen, Vernehmlassungen oder Mitwirkungen», so Bütler. Da die Arbeit im Gemeinderat in Toffen kein Vollamt sei, stelle die grösste Herausforderung für Bütler die Koordination dieses Nebenamts mit der Arbeit und der Familie dar.
Dass viele Menschen sich nicht für ein gemeindepolitisches Amt begeistern können, liegt gemäss Bütler am Aufwand und den Anforderungen. Diese würden immer grösser. «Der Verwaltungsapparat wird riesig und oft ist die Arbeit von rechtlichen Abklärungen geprägt», so Bütler. Zudem «ist man auch vielmals Zielscheibe für Angriffe bei Unzufriedenheiten». Bei einer kleinen Gemeinde sei auch die Verwaltung klein und entsprechend viel operative Arbeit bleibe beim Gemeinderat. «Das schreckt oftmals ab und die Entlöhnung deckt dies selten ab.»
Eine gute und starke Verwaltung könne dabei helfen, das Amt attraktiver zu machen. Der Rat könne sich dann wirklich nur auf das Politische konzentrieren. Auch die Abgeltung sollte zeitgemäss und die Wertschätzung grösser sein.