Landwirtschaft im Umbruch?
wissenschaftscafé Thun • Wie denken verschiedene Konsumenten über gentechnische Verfahren als ein mögliches Werkzeug für die Landwirtschaft, Klimawandel und Ernährungssicherheit? Angela Bearth, Doktorin der Psychologie,Risikoforscherin und Gründerin HF Partners, Zürich, gibt Auskunft.
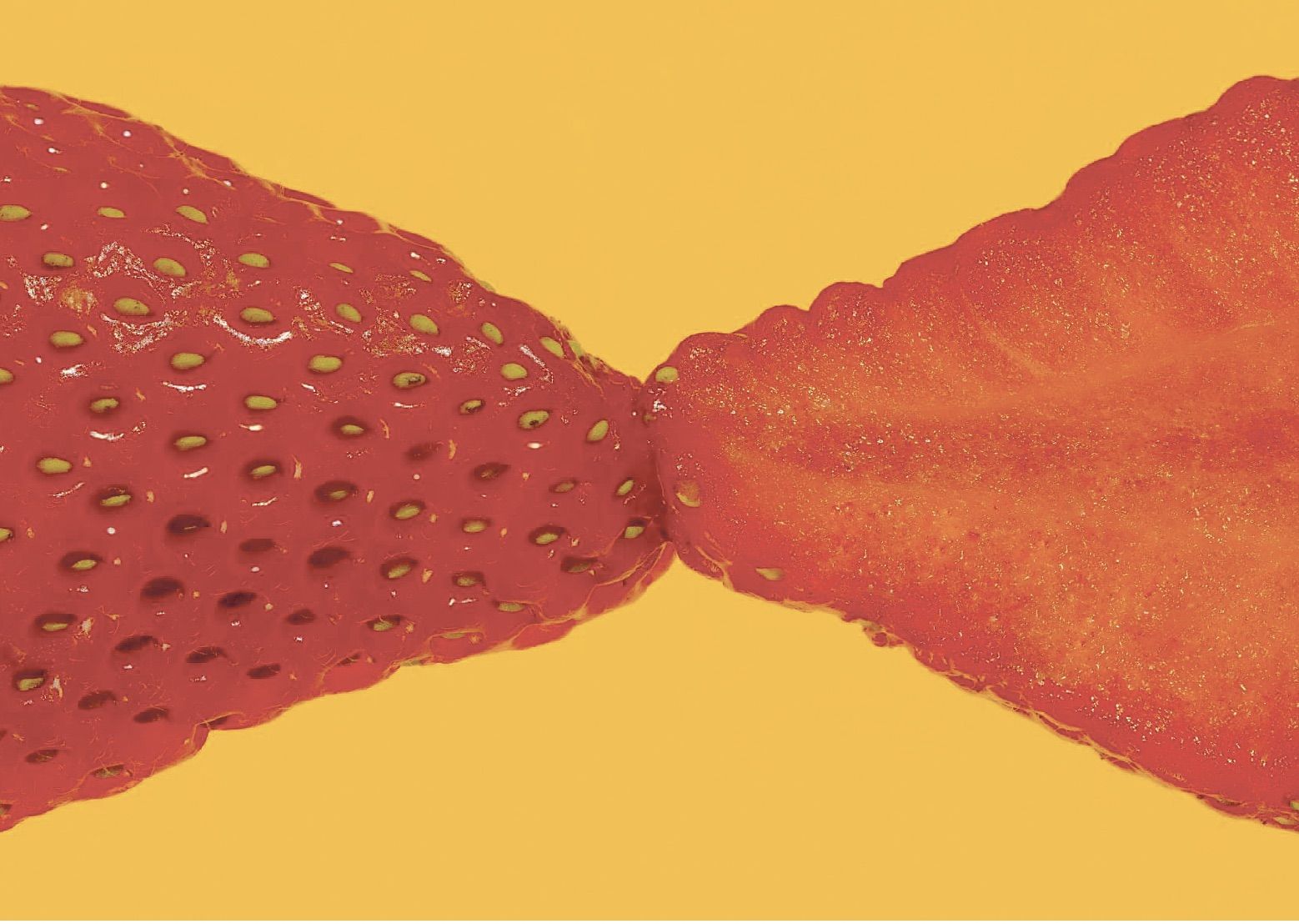
Wer darf entscheiden, ob und wie gentechnische Verfahren in der Landwirtschaft angewendet werden? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Industrie? Oder wir als Gesellschaft? Und brauchen wir mehr Transparenz, etwa durch Kennzeichnung?
In Zusammenarbeit mit dem Forum Genforschung der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, SCNAT, geben drei Referentinnen und Referenten (siehe Box) Auskunft in Bezug auf das brisante Thema. Wir sprechen im Vorfeld mit Angela Bearth, Doktorin der Psychologie und Risikoforscherin.
Was der Konsument fürchtet
Angela Bearth forscht in Bezug auf die Risiken von neuen technischen Errungenschaften. Das heisst, dass sie nicht die «Sache an sich» erforscht, wie dies in Bezug auf oben erwähntes Thema die Naturwissenschaftlerinnen und Techniker tun, sondern die Einstellungen und das daraus resultierende Verhalten der Gesellschaft. «Ich erforsche, welche Wünsche die Bevölkerung bezüglich neuer Technologien hat», so Bearth. «Wofür sie offen ist und wofür nicht und auf welchen Grundlagen diese Wünsche basieren.»
Natürlich stelle sich zu Beginn dieser Forschung stets die Frage, wie viel die oder der Einzelne über eine Sache wüssten. «Die Datengrundlage ist nicht immer sauber», so Bearth, was bedeute, dass gewisse Daten über Konsumenteneinstellungen oder -verhalten hierzulande schlicht nicht vorhanden seien. So stelle sich die Frage, «ob sich die Methode eignet, um die Fragen nach der Konsumentenakzeptanz von gentechnischen Verfahren zu beantworten».
Mit ihren Forschungen habe sie begonnen, weil sie interessiere, was der Konsument, die Konsumentin eigentlich wolle und was nicht. Im Unterschied dazu, was man denke, was die Gesellschaft wolle. Respektive: «Was die Gesellschaft wirklich für gefährlich oder nützlich hält und was nicht und weshalb oder weshalb nicht.»
Der Nutzen ist das Geheimnis
So habe die Forschung gezeigt, dass Menschen Technologien befürworteten, «wenn sie einen Nutzen dahinter, oder hinter einem so hergestellten Produkt sehen. Oder auch in Bezug auf den wirtschaftlichen Gewinn.» Bearth erläutert es anhand eines Smartphones: «Wenn sie hören, es gebe ein neues, kleines Gerät, das Strahlung abgebe, die mit grosser Wahrscheinlichkeit ungefährlich sei, so werden sie das Gerät nicht kaufen. Wenn sie aber hören, dass man mit dem Gerät telefonieren, fotografieren usw. kann, dann wahrscheinlich schon …»
Weniger Pestizide nötig
So sei es auch bei den gentechnisch veränderten Lebensmitteln. «Um zu erfahren, wie es die Bevölkerung sieht, wäre eigentlich eine Abstimmung das Sinnvollste», so Bearth. Doch da diese zurzeit nicht zur Diskussion stehe, habe man eine Forschungsumfrage gestartet, die eine breite Bevölkerungsschicht abdecke, das heisst, Menschen aus jeder Lebensphase, Frauen und Männer, Landwirte und Menschen, die der Landwirtschaft eher fern sind. Und diese habe ergeben, dass rund die Hälfte der Befragten die Gentechnologie befürworte, wenn diese einen relevanten Nutzen für die Gesellschaft oder den Konsumenten bringe.
Bearth erklärt es anhand der Kartoffel. «Man möchte eine Kartoffel so gentechnisch verändern, dass sie zum Beispiel resistent oder zumindest resistenter in Bezug auf die Kraut- und Knollenfäule ist. Was wiederum bedeutet, dass weniger Kupfer oder synthetische Mittel eingesetzt werden müssten.» Ob die Konsumenten und Konsumentinnen dies als Vorteil sehen, sei allerdings individuell unterschiedlich. «Was als Nutzen gesehen wird, ist sehr individuell – während manche Konsumenten gerne einen Apfel hätten, der beim Anschneiden nicht braun wird, sehen dies andere als eher unwichtig an.»
Zurück zur Kartoffel. «Wäre eine Kartoffel also resistenter gegen Fäule, müsste weniger gespritzt werden.» Wir würden also die Wahl zwischen Fungiziden haben (ein Fungizid ist ein chemischer oder biologischer Wirkstoff, der Pilze oder ihre Sporen abtötet oder ihr Wachstum für die Zeit seiner Wirksamkeit verhindert) und dem Eingriff in das Genmaterial, zum Beispiel mittels Gentechnologie. «Wenn man es genau nimmt, so greifen Menschen schon seit Tausenden von Jahren durch Züchtung in die Entwicklung von Pflanzen ein.» Allein mit dieser Erkenntnis werde der Gentechnologie eventuell etwas vom Schrecken genommen.
Fäule war Grund für Hungersnöte
«Die Erklärung, dass es durch Gentechnologie weniger Pestizide brauche, konnte die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern. Ich war vom Ergebnis überrascht», so Bearth. So gelte es, stets den «ganzen Werkzeugkasten» anzuschauen, das heisse: «Wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, um die Landwirtschaft zu stärken, bevor etwas be- oder verurteilt wird.» So stelle sich die Frage, ob man in der Landwirtschaft grundsätzlich etwas verändern wolle oder eher die Symptome bekämpfen. Und auch, «was überhaupt möglich ist mit den momentanen Voraussetzungen und was nicht».
Oft schon habe sie mit Naturwissenschaftlern gesprochen, ob man die Entscheidung in Bezug auf die grossen, aber auch schwierigen Themen nicht ihnen überlassen sollte. «Sie sind die Experten auf ihren jeweiligen Gebieten.» Doch so fühle sich das Volk verständlicherweise nicht ernst genommen. Fragen blieben unbeantwortet, Ängste würden nicht berücksichtigt oder entkräftet. «Es geht darum, die Gesellschaft auf die bestmögliche Art abzuholen, damit ein Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft entstehen kann.»
So sorgten sich viele Menschen in
Bezug auf die Konsequenzen der Gentechnologie. «Sie sagen, es sei gefährlich, im Genpool rumzupfuschen.» Andere seien offen, um, zum Beispiel, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wieder andere sorgten sich, was mit den Bauern geschehe. Wie stark sich die Landwirtschaft verändere. Ob nur noch grosse Firmen zum Zuge kämen. Ob Gentechnologie eine Gefahr für Mensch und Natur darstelle? Eben: «Gentechnologie ist im Prinzip dasselbe wie Züchtungen. Es lässt sich heute damit gezielter etwas verändern.» Auch die Mutagenese zum Beispiel, das Einsetzen von chemischen Substanzen oder das Bestrahlen in der Pflanzenzucht, würden bereits seit Jahren angewendet. Diese könnten nicht gut kontrolliert werden. Die sogenannte Genom-Editierung, eine neue genomische Technik, sei in mancher Hinsicht präziser.
Mit dem Argument «Konsumenten wollen es nicht» werde seit Jahren jede Debatte über Gentechnologie in der Landwirtschaft abgewürgt. «Dabei ist erstens nicht klar, was Konsumierende wollen, und zweitens hängt dies stark von der Debatte ab.




