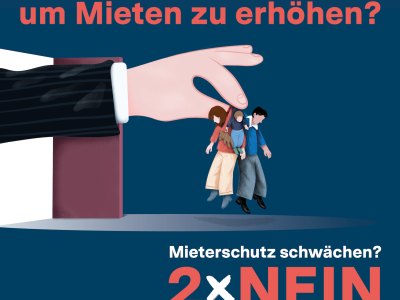«Die Demokratie muss zu einem Politikfeld werden»
Interview | Daniel Graf ist Mitgründer der Stiftung für direkte Demokratie und sieht sich als Radikaldemokrat. Sein Ziel? Die Schweizer Demokratie zugänglicher und fit für die Zukunft machen. Er plant eine neue Verfassung, die von Bürgerinnen und Bürgern selbst mitgeschrieben wird.

Warum wurde die Stiftung für direkte Demokratie gegründet?
Wegen WeCollect. So heisst unsere Onlineplattform, mit der wir Bürgerinnen und Bürger helfen wollen, Unterschriften für Initiativen und Referenden im Internet zu sammeln. Die Idee vor rund zehn Jahren war simpel: Über einen Link können Leute schnell und unkompliziert Unterschriftenbogen anfordern, ausdrucken und weiterleiten. So haben wir eine Community von mehr als 150 000 Menschen aufgebaut – und irgendwann bemerkt, dass wir zusammen eigene Projekte stemmen können. Also fähig sind, selbst Initiativen und Referenden zu starten.
Ohne Partei im Rücken?
Ja, genau. Bei vielen Projekten steht keine Partei, keine grosse Dachorganisation und kein grosser Interessenverband dahinter. Unser erstes Referendum war gegen die Überwachung von Versicherten 2018. Viele Leute kennen das als «Twitter-Referendum», weil die Schriftstellerin Sibylle Berg als Erste auf Twitter dafür mobilisiert hat. Das hat uns gezeigt: Wir können das schaffen, auch ohne grosse Partei, Verband oder Organisation im Rücken. Trotz Niederlage an der Urne war das Referendum ein Erfolg. Aus diesem Netzwerk entstand später die Inklusions-Initiative, die sich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen einsetzt und im September eingereicht wurde.
Wie wurde aus WeCollect eine Stiftung?
WeCollect war damals mein persönliches Herzensprojekt, in das ich viel Zeit und auch Geld investiert habe. Doch ich habe die Plattform nie als persönlichen Besitz betrachtet, sondern als politisches Instrument. Darum habe ich die Plattform der Stiftung für direkte Demokratie überschrieben und die Community gebeten, das Kapital für die erste Crowd-Stiftung der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Das hat geklappt, auch wenn wir eine Stiftung mit sehr beschränkten Geldmitteln geblieben sind. Gleichzeitig konnten wir kurz nach der Gründung zeigen, was alles möglich ist.
Was war möglich?
Eine Volksabstimmung zu gewinnen! 2019 starten wir mit dem E-ID-Referendum unser zweites Grossprojekt. Es ging damals um die Frage, wer in der Zukunft unseren digitalen Pass ausstellt – der Staat oder private Firmen? Für uns war klar: Das muss eine staatliche Aufgabe bleiben. Und wir hatten mit 64 Prozent Erfolg – gegen den Bundesrat, das Parlament und die Wirtschaft. Das war der Startschuss für eine staatliche, sichere und datensparsame E-ID. Sie soll bis 2025 fertig sein.
Die E-ID war kürzlich wegen des Unterschriftenbetrugs ein Thema.
Ja, gerade erst ist der «Unterschriften-Bschiss» aufgeflogen, wo kommerzielle Sammler massenweise Unterschriften gefälscht haben. Das hat das Vertrauen in die Demokratie erschüttert. Mit dem E-ID-Referendum haben wir bereits daran gearbeitet, dass wir eine digitale Unterschriftensammlung erhalten, die überprüfbar und sicher ist.
Wie sicher ist das Unterschriftensystem heute?
Ehrlich gesagt: Es ist nicht mehr sicher. Die Gemeinden überprüfen zwar jede Unterschrift und finden vielleicht einige gefälschte Unterschriften, aber eben nicht alle. Das ist eine schlechte Nachricht für das Vertrauen in unsere Demokratie.
Was müsste sich ändern?
Wir brauchen dringend E-Collecting, also ein digitales System. Das wäre eine sichere Lösung, um Initiativen und Referenden auf dem Smartphone oder am Computer zu unterzeichnen. Und der Vorteil: Es wäre viel einfacher für die engagierten Menschen, im Freundeskreis oder auch auf der Strasse zu sammeln.
Und wozu braucht es die Stiftung für direkte Demokratie?
Wir haben gemerkt, dass im heutigen System etwas fehlt. Nämlich eine Organisation oder ein Netzwerk, das sich für die direkte Demokratie und vor allem auch für die Weiterentwicklung unseres politischen Systems einsetzt. Das ist doch überraschend, wenn man bedenkt, was die Schweiz ausmacht. Auch in der Bundesverfassung gibt es keinen Auftrag, die Demokratie in der Schweiz weiterzuentwickeln. Dies funktioniert, solange alles immer gleich bleibt. Aber spätestens mit der Digitalisierung ist klar geworden, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern und bestehende Hürden abgebaut werden müssten. Doch Bund und Kanton haben keinen verfassungsmässigen Auftrag, die Demokratie zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Und in diese Lücke wollt ihr springen?
Genau, das ist die Lücke, die wir auszufüllen beginnen. Ich setze mich persönlich seit fast zehn Jahren für E-Collecting ein, doch wir hatten bisher einfach keine Chance. Bis vor einigen Wochen der Unterschriftenskandal geplatzt ist, wollte in der Schweiz kaum jemand E-Collecting haben. Doch bereits seit 2013 gibt es in der Verordnung über politische Rechte einen Artikel, der es dem Bundesrat ermöglichen würde, «Versuche zur Unterzeichnung eidgenössischer Volksbegehren auf elektronischem Wege» durchzuführen. Seit zehn Jahren liegt also ein Gesetzesartikel in der Schublade bereit. Der Bundesrat müsste also gar nicht erst ein Gesetz ausarbeiten, um ein Pilotprojekt zu starten.
Doch niemand hat den Gesetzesartikel bisher umgesetzt.
Nein, wachsende Hürden für Unterschriftensammlungen abzubauen war einfach kein Thema. Man kann nicht einfach sagen, dass es in Vergessenheit geriet, weil es nicht so wichtig ist, sondern man scheute sich bisher davor, aus Angst vor einer Machtverschiebung. Ob das stimmt, ist noch eine andere Frage. Doch weil man davor Angst hatte, dass die Bürgerinnen und Bürger plötzlich zu viele Initiativen oder Referenden ergreifen, riskierte man eigentlich, das gesamte System an die Wand zu fahren. Das ist schlicht fahrlässig. Erst jetzt ist der Sicherheitsgedanke so zentral, dass kein Weg an E-Collecting vorbeiführt. Es ist bezeichnend, dass erst ein gravierendes Sicherheitsproblem eine wichtige Baustelle der Demokratie aufgetan hat.
Sie wollen die Demokratie also auch zugänglicher machen?
Ja, unsere Stiftung will die Hürden für die Teilnahme senken, auch für junge Menschen, für die das Smartphone das Werkzeug für Partizipation ist – nicht mehr Papier und Stift. In unserem Fokus sind besonders die Volksrechte, darunter Initiativen und Referenden. Sie dürfen nicht nur für diejenigen sein, die viel Geld haben, um Unterschriften bei Sammelfirmen zu kaufen. Sonst haben wir eine Pizza-Demokratie ohne freiwilliges Engagement: Es wird nur noch bestellt, bezahlt und geliefert. Mit digitalen Mitteln könnten wir die Demokratie für alle zugänglicher und nutzbar machen. Es geht dabei nicht nur um die digitale Unterschriftensammlung, sondern um vieles mehr.
Um was geht es denn noch?
Das Abstimmungsbüchlein ist ein gutes Beispiel dafür, wie veraltet das System ist. Es wird streng geheim gedruckt, und wenn es in Millionenauflagen veröffentlicht und verschickt ist, gibt es praktisch keine Möglichkeit mehr, Fehler zu korrigieren oder zu diskutieren. Dabei könnte man das einfach auf eine digitale Plattform packen, wo man Fragen stellen, Fakten checken und sich austauschen kann. Das Abstimmungsbüchlein könnte zu einem digitalen Forum werden, welches den Meinungsbildungsprozess unterstützt und aus meiner Sicht deutlich verbessern könnte. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Medien.
Steht die Schweiz in Sachen Demokratie still?
Die Schweiz ist in vielen Bereichen modern – doch bei der digitalen Demokratie hinken wir hinterher. Man hat vergessen, dass auch die Demokratie ständig weiterentwickelt werden muss. Sie muss zu einem eigenen Politikfeld werden, das aktiv gepflegt wird. Es fehlt an Politikerinnen und Politiker, die sich für die direkte Demokratie stark machen.
Wie offen sind die Parteien für solche Ideen?
Die Parteien hinken hinterher. Umfragen zeigen, dass in der Bevölkerung die Digitalisierung der Demokratie wie E-Voting oder E-Collecting breit abgestützt ist. Wenig überraschend sind Radikaldemokratinnen und -demokraten, zu denen ich mich auch zähle, parteipolitisch eher an den Rändern gestreut. Das sind Leute, die kritisch gegenüber den Institutionen wie Parlament, Bundesrat oder Kantone sind. Und kritisch sein heisst nicht, dass man die Institutionen ablehnt, sondern dass man diese einfach hinterfragt. Demokratie ist etwas, das sich weiterentwickeln soll und kann. Ich bin zudem überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Digitalisierung mehr Verantwortung übernehmen können. Sich als Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln, heisst auch, mehr Kompetenzen, aber auch mehr Pflichten zu erhalten. Das ist nicht wirklich eingeplant in unserer Demokratie.
Sie haben eine Initiative für eine neue Verfassung ins Gespräch gebracht. Was hat das mit dem Thema der Demokratie zu tun?
Unsere heutige Verfassung benötigt ein Update. Viele Themen fehlen leider. Ein gutes Beispiel ist wieder das Thema Digitalisierung. Es gibt viele Fragen rund um das Internet: Wer hat Zugang? Wer ist verantwortlich? Wer sorgt für die Sicherheit? Das alles müsste geklärt werden. Eine Totalrevision könnte das regeln. Mit Artikel 138 der Bundesverfassung können wir Bürgerinnen und Bürger notwendige Veränderungen anstossen. 100 000 Unterschriften genügen, um eine Volksinitiative zu starten und eine Verfassungsrevision in Gang zu setzen.
Sie sprechen von einem «Update» der Bundesverfassung.
Ja, mit dem Begriff «Update» wollen wir deutlich machen, dass es nicht darum geht, in der Bundesverfassung alles über den Haufen zu werfen und bei null anzufangen. Es geht darum, das Bestehende zu überprüfen, zu erkennen, was noch zweckmässig ist, wo Lücken bestehen und was verbessert werden muss. Es ist eine Aktualisierung, kein kompletter Neustart.
Wer schreibt die zeitgemässe Verfassung?
Ist die Volksinitiative an der Urne erfolgreich, erhält ein neu gewähltes Parlament den Auftrag. Der erste Entwurf soll aber von Bürgerinnen und Bürger kommen. Wir wollen einen Verfassungsrat ins Leben rufen. Dieser soll – mithilfe von Fachpersonen – einen mehrheitsfähigen Entwurf erarbeiten. Dazu wollen wir mit digitalen Plattformen und schweizweiten Diskussionsveranstaltungen sicherstellen, dass möglichst viele Menschen an der neuen Verfassung mitdiskutieren können.
Dieses Projekt ist zurzeit auf Eis gelegt. Warum?
Wir müssen mit der Unterschriftensammlung noch mindestens zwei Jahre warten. Wenn wir die Initiative gewinnen, gibt es Neuwahlen des Parlaments – das wäre historisch. Aber wir wollen, dass dies regulär mit den normalen Wahlen zusammenfällt, um nicht zusätzliche Angriffsfläche zu bieten.
Wie gross war die Unterstützung für dieses Projekt?
Beim ersten Anlauf haben uns 10 000 Menschen Unterstützung zugesagt. Aber der Zeitpunkt ist gerade schwierig, weil viele Menschen Angst haben – vor allem wegen der Folgen des Ukrainekriegs und der allgemeinen Unsicherheit. Da trauen sich manche kaum an grosse Veränderungen heran. Wir bleiben dran. Denn beim Schutz und der Weiterentwicklung der direkten Demokratie spielt die Politik auf Zeit, die wir nicht mehr haben.