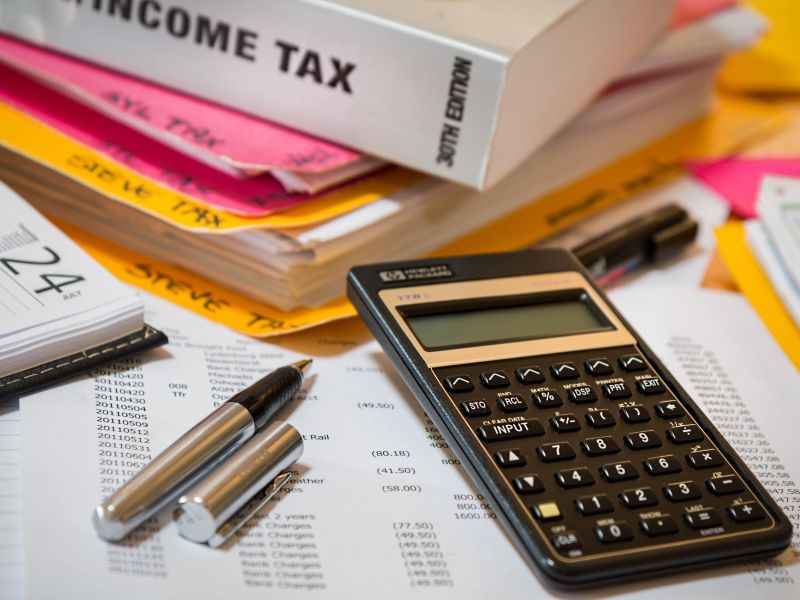Das Schlagwort Bürokratie
Verwaltung • Sowohl auf kantonaler Ebene wie auch auf Bundesebene wird in der Politik oder auch in privaten Gesprächen häufig kritisiert, dass zu viel Geld in die Verwaltung und in eine uferlose Bürokratie fliesse.
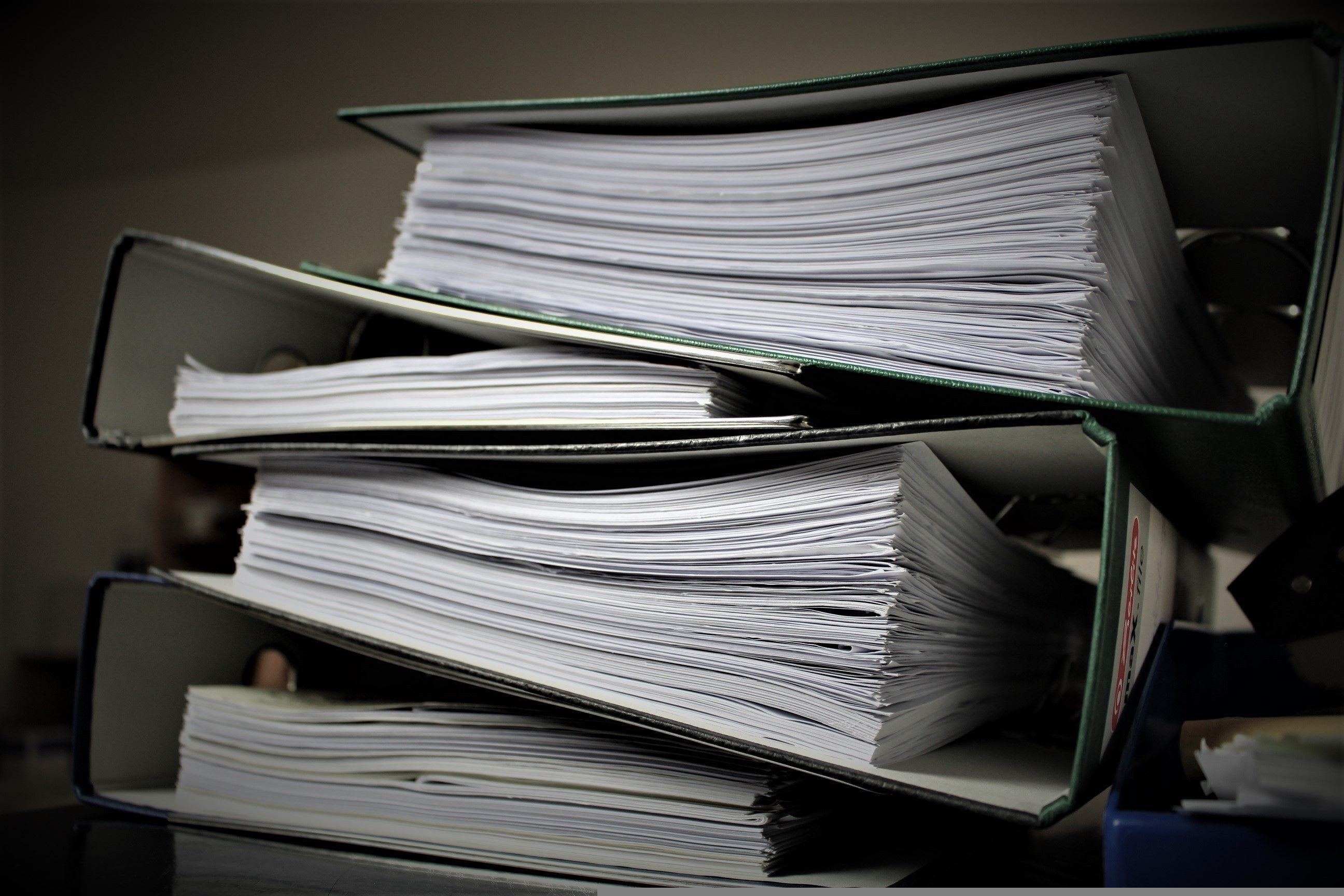
«In der trumpschen oder muskschen Gegenwart hat die pauschalisierte Kritik an der Verwaltung wieder Hochkonjunktur», wie Prof. Dr. Adrian Ritz erklärt. Ritz ist geschäftsführender Direktor des Kompetenzzentrums für Public Management und hat eine Professur für Public Management an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Bern. Ob eine solche Kritik aber gerechtfertigt ist, lässt sich so einfach nicht beantworten. «An einem Ort ja, am anderen Ort nein», so Ritz. «Pauschalisiert aber zumindest für die Schweiz nicht.» Denn sowohl die Bürokratie als auch die Staatsquote der Schweiz lägen in internationalen Vergleichen nicht an der Spitze. Doch Optimierungspotenzial gebe es immer. Darum müsse die Verwaltung selbst kontinuierliche Reformen und Sparprogramme initiieren, «damit es keine Kahlschläge à la Trump und Musk braucht». Diese Kahlschläge richteten letztlich wohl mehr Schaden als Gewinn an.
Der Staat sei keine risikoorientierte Firma oder ein Start-up, sondern eine gesellschaftliche Institution. Als eine solche sei sie eher risikoavers und müsse um Stabilität besorgt sein. «Das ist nicht immer effizient», so Ritz, «aber langfristig mehr zum Wohl der Gesellschaft.» Beim Staat gehe es nicht nur um Effizienz. Auch Effektivität, Gleichbehandlung und Verantwortlichkeit seien Ziele unseres Staatswesens.
Bürokratieabbau
Bürokratieabbau sei aber ständige Aufgabe und finde auf drei Ebenen statt: Wenn der Staat zu viele Aufgaben übernehme, müsse sich die Politik zügeln, «denn sie ist versucht, mehr Gelder für ihre Klientel auszugeben oder Partikularinteressen zu fördern», sagt Ritz. Hier könne die Verwaltung wenig dagegen machen, da sie den Auftrag von der Politik erhalte.
Zweitens gebe es bei der Gesetzgebung Bürokratie, also zu viele und zu komplizierte Gesetze. Auch hier sei die Politik gefragt, weil nicht alles geregelt werden müsse, wo sich jemand beklage. «Aber hier gilt: Des einen Freud ist des anderen Leid», sagt Ritz. Bauernvertreter oder jene des Gesundheitswesens seien kaum gegen jene Regulierungen, die ihnen dienten. Doch ob immer sinnvoll, sei eine andere Frage. Hier komme aber auch der Verwaltung die Aufgabe zu, möglichst einfach und wenig zu regulieren, wenn sie es schon tun müsse. Drittens gebe es Bürokratie im Verwaltungsapparat und zwischen zusammenarbeitenden Behörden, wie beispielsweise zu komplizierte Prozesse, zu umständliche Arbeitsweise oder eine träge Organisationskultur. «Dafür ist die Verwaltung verantwortlich», so Ritz. «Sie muss hier mit dem Bürokratieabbau täglich vorausgehen.»
Wenn auf all diesen Ebenen verantwortungsvoll im Sinne des Gemeinwohls, der Eigenverantwortung, der Sparsamkeit und nicht für Partikularinteressen gehandelt werde, dann sei Bürokratieabbau möglich, ohne grössere wirtschaftliche, soziale und ökologische Einbussen. «Selbstverständlich hat aber alles seinen Preis, und alles ist nie möglich», so Ritz.
Ein Schlagwort
Begriffe wie «Bürokratie» und «Deep State» seien Schlagwörter, die als Keule emporstilisiert würden. Der Verwaltungsstaat bezeichne die Übernahme von Aufgaben durch das Staatswesen und deren Professionalisierung. «Im Gegensatz zur laienhaften Erledigung von ‹Verwaltungsarbeit› im Feudalstaat ist der Verwaltungsstaat eigentlich ein Erfolgsmodell der vergangenen 200 Jahre», sagt Ritz.
Kritik an der Verwaltung sei legitim und wichtig, doch sie wehre sich nicht dagegen. «Zudem vergisst man zu oft, was eigentlich der Mehrwehrt der Verwaltung ist.» Ein gesellschaftliches Vorankommen in Bereichen wie Ernährung, Gesundheit, Hygiene, Sicherheit oder Verkehr sei in Abhängigkeit des professionalisierten Verwaltungsstaats entstanden. Kern davon seien Institutionen und professionelle Akteure, die sich für eine qualitativ gute und vor allem auch nachhaltige Umsetzung des politischen Willens bemühten. «Die Gesellschaft hat diesen Institutionen immer wieder diese Aufgaben übertragen», sagt Ritz, «weil man die Erfahrung gemacht hat, dass sie es verhältnismässig gut, uneigennützig und gemeinwohlfördernd tun.» Die grosse Mehrheit habe davon profitiert.
Und klar zahlten alle etwas dafür, die über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügten. Das sei gerade das Ziel des gesellschaftlichen Ausgleichs. Doch das schliesse eine Modernisierung und allfällige Sparprogramme ja nicht aus.
Government Bashing
Anders gesagt, die grosse Mehrheit der Gesellschaft wisse die Fortschritte des Verwaltungsstaats der vergangenen zwei Jahrhunderte eigentlich zu würdigen. «Die Mehrheit der Gesellschaft ist auch bereit, dafür zu bezahlen». Das Problem beginne dort, wenn sie anfange zu glauben, der Verwaltungsstaat sei korrupt, schlecht oder gegen sie – das heisst, wenn die Politik versuche, eine Trennung zwischen Gesellschaft und Staat zu schaffen. In einer Demokratie gehören die beiden unweigerlich zusammen. «Das ist das Mittel, welches Trump et al. anwenden», sagt Ritz. «Sie versuchen, den Staat schlechtzureden und -machen.»
Im Falle der USA sei das «Government Bashing» seines Erachtens ein politisches Programm. Die wirklichen Auswirkungen davon würden wir erst in ein paar Jahrzehnten sehen. «Wenn das Ziel dieses Bashings darin besteht, den Staat auszuhöhlen, ihm seine Kompetenzen zu nehmen und die Bürger dadurch in ihren Befürchtungen zu bestätigen, dass er nicht funktioniert, könnte das längerfristig problematischere Auswirkungen haben als die Ineffizienzen, welche es in jedem Staatswesen gibt», sagt Ritz.
Im Schweizer Staatswesen sei die Bürokratie im negativen Sinne nicht so stark ausgeprägt wie teilweise behauptetet werde. Natürlich sei Bürokratie immer zu viel, wenn man davon direkt negativ betroffen sei oder das Gefühl habe, zu viel dafür zahlen zu müssen. Doch andere wiederum profitierten davon. Oder wie Ritz sagt: «Gesellschaftlicher Ausgleich ist kein falscher Ansatz in einer Demokratie.» Denn die Stärke einer Demokratie bemesse sich am Wohl der Schwächsten und am Einbezug aller.
Zudem liege die Schweiz beim öffentlichen Personal, bei den Staatsausgaben und der Staatsquote im Vergleich nicht an der Spitze. Ein Vorteil sei diesbezüglich unsere direkte Demokratie und das Subsidiaritätsprinzip zwischen den drei Staatsebenen Bund, Kanton und Gemeinde. «Möglichst viel soll nahe beim Bürger erledigt werden», erklärt Ritz, «denn dann wird das gemacht, was wirklich nötig ist.» Auch würden die Ausgabeposten direkter ersichtlich, und man könne rascher auf finanzielle Ungleichgewichte reagieren. Deshalb hätten wir eine vergleichsweise schlanke Bundesverwaltung. «Viele Aufgaben werden von den Kantonen und Gemeinden erledigt und finanziert», so Ritz.